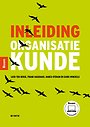1 Einleitung.- 1.1 Entstehung und Aufbau des CeA-Forschungsverbundes.- 1.2 Überblick über Ziele, Ergebnisse und Perspektiven des CeA-Forschungsverbundes.- 1.2.1 Neuere Anforderungen an Technik durch neue Formen der Betriebs- und Arbeitsorganisation.- 1.2.2 Erfahrungsgeleitete Arbeit - eine notwendige Voraussetzung für flexible Produktion.- 1.2.3 CeA - Technik als „Werkzeug“.- 1.2.4 CeA - eine neue Perspektive für zukunftsweisende Innovationen.- 1.3 Literatur zu Kapitel 1.- 2 Erfahrungsgeleitete Arbeit mit CNC- Werkzeugmaschinen.- 2.1 Sozialwissenschaftliche Grundlagen des CeA- Ansatzes.- 2.1.1 Bedarf an qualifizierten Fachkräften bei fortschreitender Technisierung.- 2.1.2 Erfahrungswissen - eine wichtige, bisher unterschätzte Qualifikation.- 2.1.3 Erfahrungswissen - bisher vorherrschende Sichtweise.- 2.1.4 Subjektivierendes Handeln - eine neue Sichtweise des Erfahrungswissens und seiner Grundlagen.- 2.2 Systematik und Topologie kritischer Arbeitssituationen.- 2.2.1 Kritische Arbeitssituationen bei der Prozeßvorbereitung.- 2.2.2 Kritische Arbeitssituationen bei der Prozeßlenkung.- 2.2.3 Kritische Arbeitssituationen bei der Prozeßauswertung.- 2.2.4 Merkmale kritischer Arbeitssituationen in der Zerspanung.- 2.3 Leistungen und konstitutive Komponenten erfahrungsgeleiteter Arbeit.- 2.3.1 Besondere Leistungen qualifizierter Arbeitskräfte mit CNC-Werkzeugmaschinen.- 2.3.2 Konstitutive Komponenten erfahrungsgeleiteter Arbeit mit CNC-Werkzeugmaschinen.- 2.4 Bedarf und Perspektiven zur technischen Unterstützung erfahrungsgeleiteter Arbeit.- 2.4.1 Defizite gegenwärtig bevorzugt eingesetzter CNC- Technik.- 2.4.2 Perspektiven für Optionen zur technischen Unterstützung erfahrungsgeleiteter Arbeit.- 2.5 Ökonomische Aspekte erfahrungsgeleiteter Arbeit.- 2.5.1 Wirtschaftliche Bewertung von technischen Veränderungen.- 2.5.2 Probleme der Prozeßzugänglichkeit und der Nutzung von Erfahrung bei der Anwendung der NC- Technik.- 2.5.3 Ökonomische Effekte eines verschlechterten Prozeßzugangs bei der Arbeit an CNC-Werkzeugmaschinen.- 2.6 Interdisziplinärer Erfahrungsaustausch als methodische Forschungsstrategie.- 2.6.1 Fragestellung und Methode.- 2.6.2 Schwerpunkte im Forschungsvorhaben.- 2.6.3 Organisation des Forschungsablaufs.- 2.6.4 Akteure der Forschung.- 2.6.5 Allgemeine Prinzipien und methodische Instrumente.- 2.6.6 CNC-Qualifizierung und Laborversuche als Einheit.- 2.6.7 Bewertung der Forschungsstrategie.- 2.7 Literatur zu Kapitel 2.- 3 Technische Funktionsbausteine zur Unterstützung erfahrungsgeleiteter Arbeit.- 3.1 Handlungsorientierte Informationsquellen und Zugriffsmöglichkeiten als alternative Ein- und Ausgabemedien.- 3.1.1 Verschiedene Sichtweisen über die Funktion der Arbeitskraft bei der automatischen Zerspanung.- 3.1.2 Handlungsorientierte Informationsquellen für Arbeitskräfte.- 3.1.3 Handlungsorientierte Ein- und Zugriffsmöglich keiten für Arbeitskräfte.- 3.2 Funktionsbausteine zur Unterstützung der Prozeßtransparenz.- 3.2.1 Visuelle Indikatoren.- 3.2.2 Akustische Indikatoren.- 3.2.3 Taktil-kinästhetische Indikatoren.- 3.3 Funktionsbausteine zur Unterstützung der Prozeßregulation.- 3.3.1 Regulation durch manuelle Prozeßführung.- 3.3.2 Regulation mittels Spracheingaben.- 3.4 Erprobung kombinierter Funktionsbausteine zur Unterstützung von Prozeßtransparenz und Prozeßregulation.- 3.4.1 Erfolgreiche Erprobung bei der Drehbearbeitung.- 3.4.2 Erfolgreiche Erprobung bei der Fräsbearbeitung.- 3.4.3 Erfolgreiche Erprobung von rechnergestützten Sprachein- und -ausgabemedien.- 3.4.4 Weitere Entwicklungsmöglichkeiten von CeA- geprägten Ein- und Ausgabetechniken unter Mitarbeit von Peter Ligner, FGAT Berlin.- 3.5 Wirtschaftlichkeit der Funktionsbausteine Matthias Klimmer und Gunter Lay, FhG-ISI Karlsruhe.- 3.6 Literatur zu Kapitel 3.- 4 Programmierung und Steuerungskonzepte.- 4.1 Programmierkonzeptionen zur Unterstützung erfahrungsgeleiteter Arbeit.- 4.1.1 Planung aus der Fertigungsperspektive.- 4.1.2 Programme als Arbeitsmittel für die Facharbeiter.- 4.1.3 Die Entwicklung einer Bearbeitungsstrategie als Weg zum Programm.- 4.1.4 Programmeingabe: DIN Oder WOP Oder manuell?.- 4.1.5 Ein Programm wird erst beim Einfahren fertiggestellt.- 4.1.6 Annäherung an die Endkontur: Schritt für Schritt anstelle einer „ex ante“ Planung.- 4.1.7 Programme als Kommunikationsmittel.- 4.1.8 Programmierkonzepte für die Fertigung.- 4.2 Overrideprotokollierung als Weg zur schrittweisen Programmierung.- 4.2.1 Die Bedeutung der Overrideprotokollierung für direkte Eingriffe in den Bearbeitungsprozeß.- 4.2.2 Die Festlegung von Schnittwerten im Programm ist „Erfahrungssache“.- 4.2.3 Überprüfung der Schnittwerte beim Einfahren.- 4.2.4 Programmoptimierung während der Bearbeitung.- 4.2.5 Handhabung herkömmlicher Override-Funktionen an CNC-Werkzeugmaschinen.- 4.2.6 Gestaltungsanforderungen an die Override- Funktionen.- 4.2.7 Technischer Lösungsansatz und prototypische Realisierung.- 4.2.8 Funktionalität des Prototypenaufbaus.- 4.2.9 Die Erprobung des Prototyps durch Facharbeiter.- 4.3 Prozeßführung und bearbeitungsorientierte Steuerungsfunktionalität an Werkzeugmaschinen.- 4.3.1 Anforderungen an eine bearbeitungsorientierte Prozeßführung.- 4.3.2 Anforderungen an steuerungstechnische Systemkonzepte zur Prozeßführung.- 4.3.3 Multimediale Prozeßführung an Werkzeugmaschinen - erste Befunde und Anforderungen.- 4.4 Literatur zu Kapitel 4.- 5 Neue arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse durch die Erforschung der Entwicklungspotentiale erfahrungsgeleiteter Arbeit.- 5.1 Erfahrungsgeleitete Arbeit als Untersuchungsgegenstand komplexer Forschungsfragen.- 5.1.1 Die Rolle von Interdisziplinarität und Nutzerbeteiligung.- 5.1.2 Zusammengefaßte Befunde aus arbeitswissenschaftlichen Untersuchungen und der Evaluation der technischen Komponenten.- 5.2 Entwicklungsperspektiven und Mindestanforderungen an die technische Unterstützung erfahrungsgeleiteter Arbeit.- 5.2.1 Entwicklungsperspektiven.- 5.2.2 Mindestanforderungen.- 5.3 Kritik und Erweiterung der arbeitswissenschaftlichen Grundannahmen über das Arbeitshandeln.- 5.3.1 Schwachstellen vorherrschender Konzepte.- 5.3.2 Konturen für eine erweiterte arbeitswissenschaftliche Problemsicht und Methodik.- 5.4 Konsequenzen für die Arbeitsforschung und Arbeitsgestaltung.- 5.4.1 Möglichkeiten und Grenzen der Nutzerbeteiligung.- 5.4.2 Paradigma für Forschung und Gestaltung.- 5.5 Literatur zu Kapitel 5.- 6 Herstellerübergreifende und nutzerorientierte Technikentwicklung als Innovationsstrategie für die Produktion im 21. Jahrhundert.- 6.1 Linear-sequentielle Entwicklungsprozesse als noch vorherrschendes Innovationsmuster im Werkzeugmaschinenbau.- 6.1.1 Vergleich der Innovationsmuster zwischen der BRD, Japan und USA.- 6.1.2 Herstellerfokussierung bei Innovationsprozessen der BRD.- 6.2 Neue Anstöße für die Organisation von Entwicklungsprozessen im Werkzeugmaschinenbau.- 6.2.1 Handlungsbezogene Angebote von Herstellern (auf der EMO 93).- 6.2.2 Erweiterung von Entwicklungsperspektiven durch den Einbezug von Nutzern.- 6.3 Vernetzt-rekursive Entwicklungsprozesse als zukünftig bedeutsame Innovationsstrategie.- 6.3.1 Nutzerorientierte Leitbilder.- 6.3.2 Notwendigkeit neuer herstellerübergreifender Kooperationsformen.- 6.3.3 Forderung nach multifunktionalen Entwicklungswerkzeugen.- 6.4 Forschungsfelder für die Produktion im 21. Jahrhundert auf der Grundlage der neuen Innovationsstrategien.- 6.5 Literatur zu Kapitel 6.- 7 Anhang.- 7.1 Liste der beteiligten Institute im CeA1-Verbund.- 7.2 Liste der beteiiigten Unternehmen.